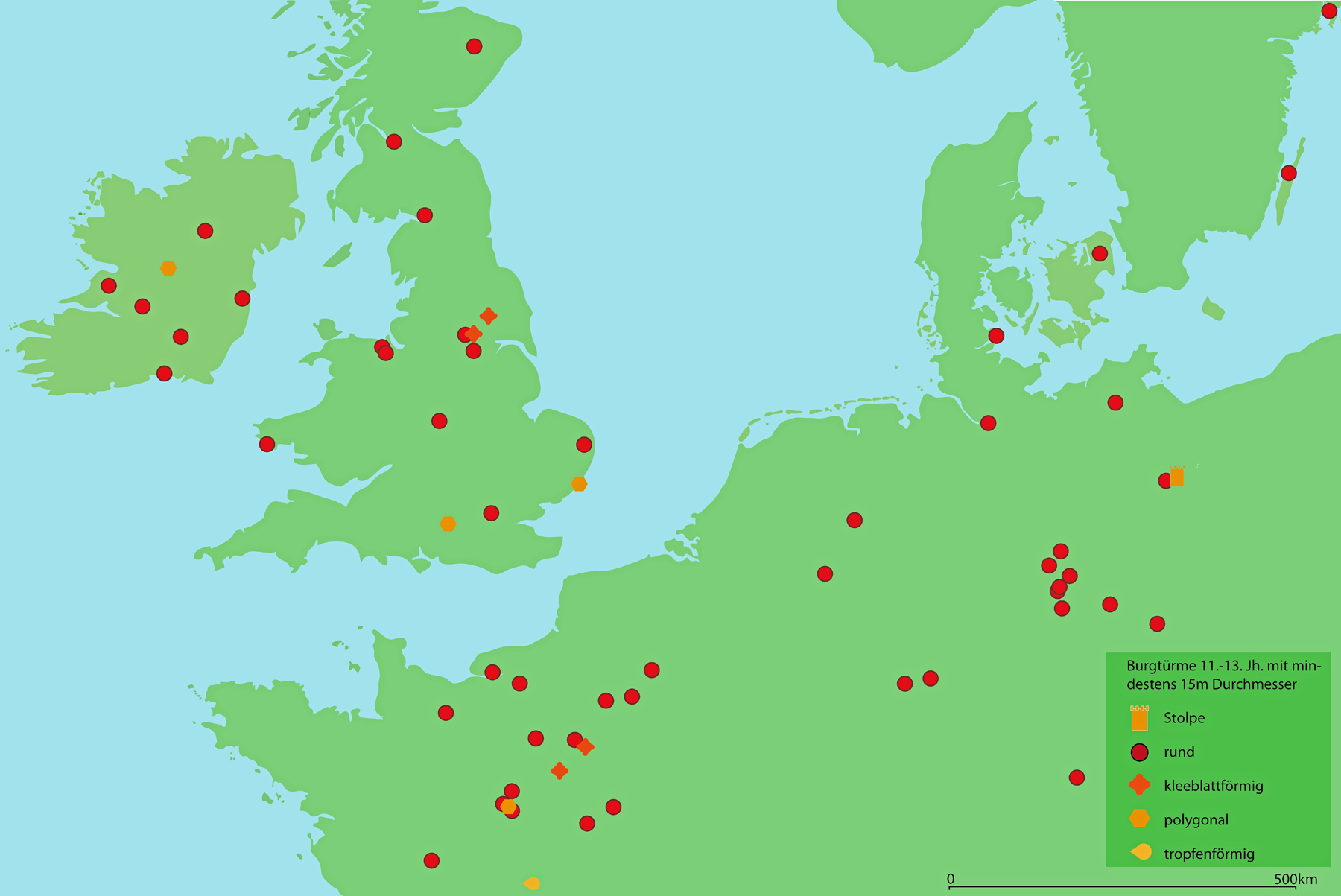Ein gestrandetes U-Boot, ein Schiff oder ein zauberhaftes Bauwerk, welches sich aus der Erde erhebt? Der Einsteinturm auf dem Potsdamer Telegrafenberg, der als Pionierwerk der Weltarchitektur gilt, lädt auch fast einhundert Jahre nach seiner Errichtung zum architektonischen Träumen ein. Geschwungene, organische Formen, die dem inneren Kern – dem Sonnenteleskop – folgen, sind sein Markenzeichen.

Am 26. September 2023 wurde der Einsteinturm nach fast einem Jahr Sanierung feierlich wiedereröffnet. Das Frühwerk des Architekten Erich Mendelsohn (1887-1953), das ab 1920 errichtet worden war, hatte schon bald nach seiner Fertigstellung erste Schäden gezeigt und musste immer wieder saniert werden. Der 20 Meter hohe Turm war bis zum Zweiten Weltkrieg das wissenschaftlich bedeutendste Sonnenteleskop in Europa. Er dient bis heute als Observatorium zur Untersuchung des Sonnenlichts, wobei anfangs der experimentelle Nachweis von Albert Einsteins Relativitätstheorie das Hauptziel war.

Die Schäden am Einsteinturm kamen schleichend und hatten in der Verwendung von damals noch neuen Materialien ihre Ursache, wie dem Eisenbeton (Stahlbeton). Während man zunächst nur oberflächliche Verfärbungen und einige Abplatzungen am Putz sah, offenbarten detaillierte Untersuchungen der Bausubstanz die eigentlichen Probleme. Die Dächer waren undicht, Holzkonstruktionen durch Feuchtigkeit beschädigt und Schadstoffe aus früheren Baumaterialien beeinträchtigten die Nutzung der Räume. Sehr hilfreich waren die gründlichen Voruntersuchungen und Dokumentationen der letzten Sanierung vor über 20 Jahren. Diese sind bei denkmalgeschützten Objekten üblich und unterstützen bei der Entwicklung von Sanierungsstrategien.

Auch in Zukunft wird das Gebäude regelmäßig Schäden aufweisen, wie es bei jedem Bauwerk der Fall ist. Daher wird eine kontinuierliche Beobachtung des Bauzustandes notwendig bleiben. Weitere Werke des Architekten Erich Mendelsohn sind zum Beispiel die Hutfabrik in Luckenwalde (Hutfabrik Friedrich Steinberg, Herrmann & Co) oder das Mosse-Verlagshaus in Berlin.

Im Gespräch mit Haiko Türk, Dezernatsleiter Praktische Denkmalpflege des BLDAM, lernen wir die architektonischen und wissenschaftlichen Besonderheiten des Einsteinturms kennen, entdecken den Stil des Architekten Erich Mendelsohn, und erfahren Details der erfolgreichen Sanierung des Bauwerks. Das Gespräch führte Anne-Marie Graatz, Pressesprecherin am BLDAM.
Transkript der Folge zum Nachlesen
Weiterführende Links
Informationen zum Einsteinturm
Informationen der Wüsentrot-Stiftung
Digitale Tour durch den Einsteinturm
Zur Rotverschiebung von Spektrallinien im Schwerefeld der Sonne

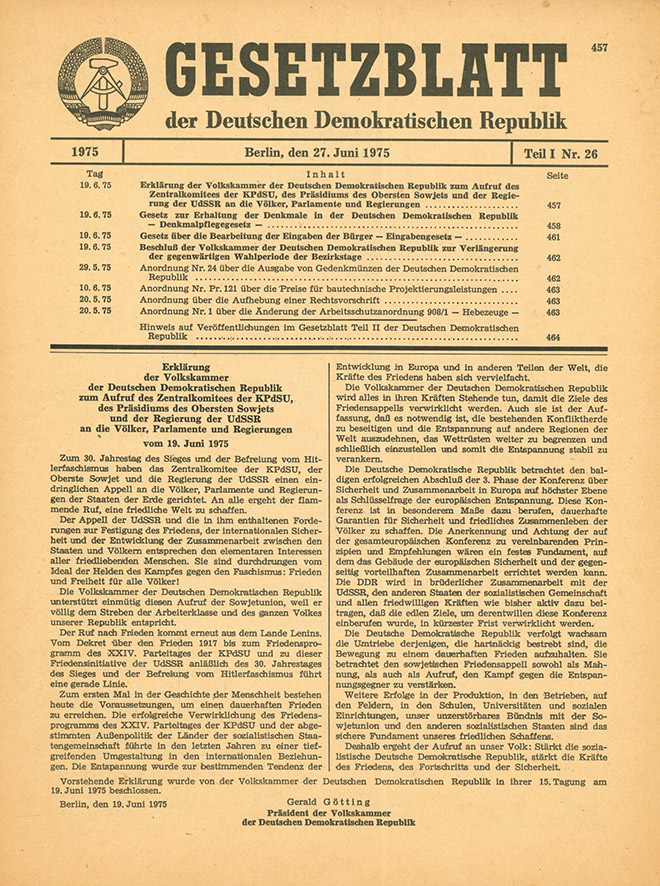
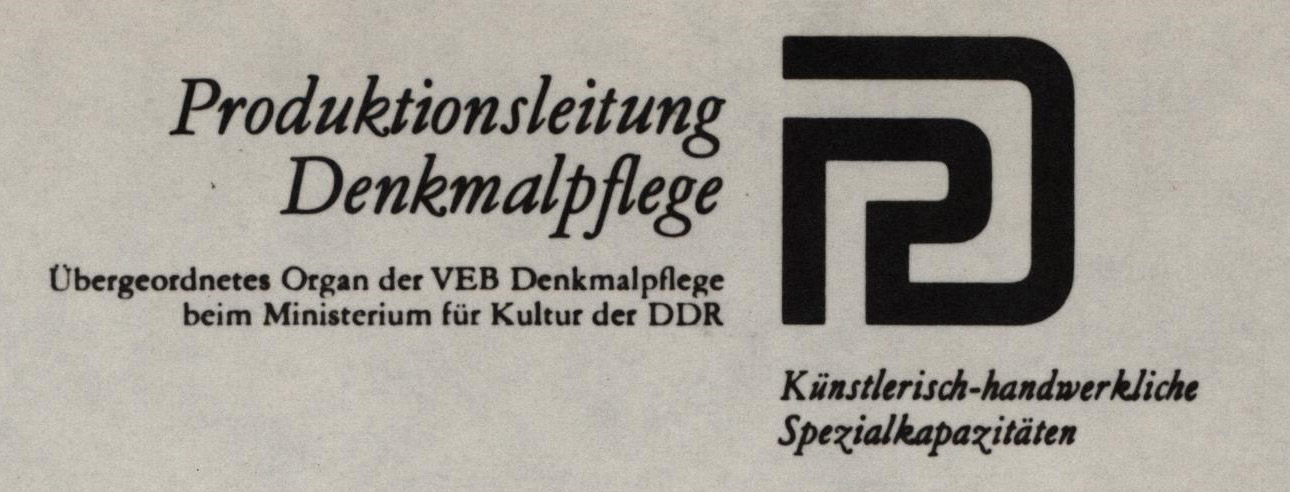
.jpg)
.jpg)


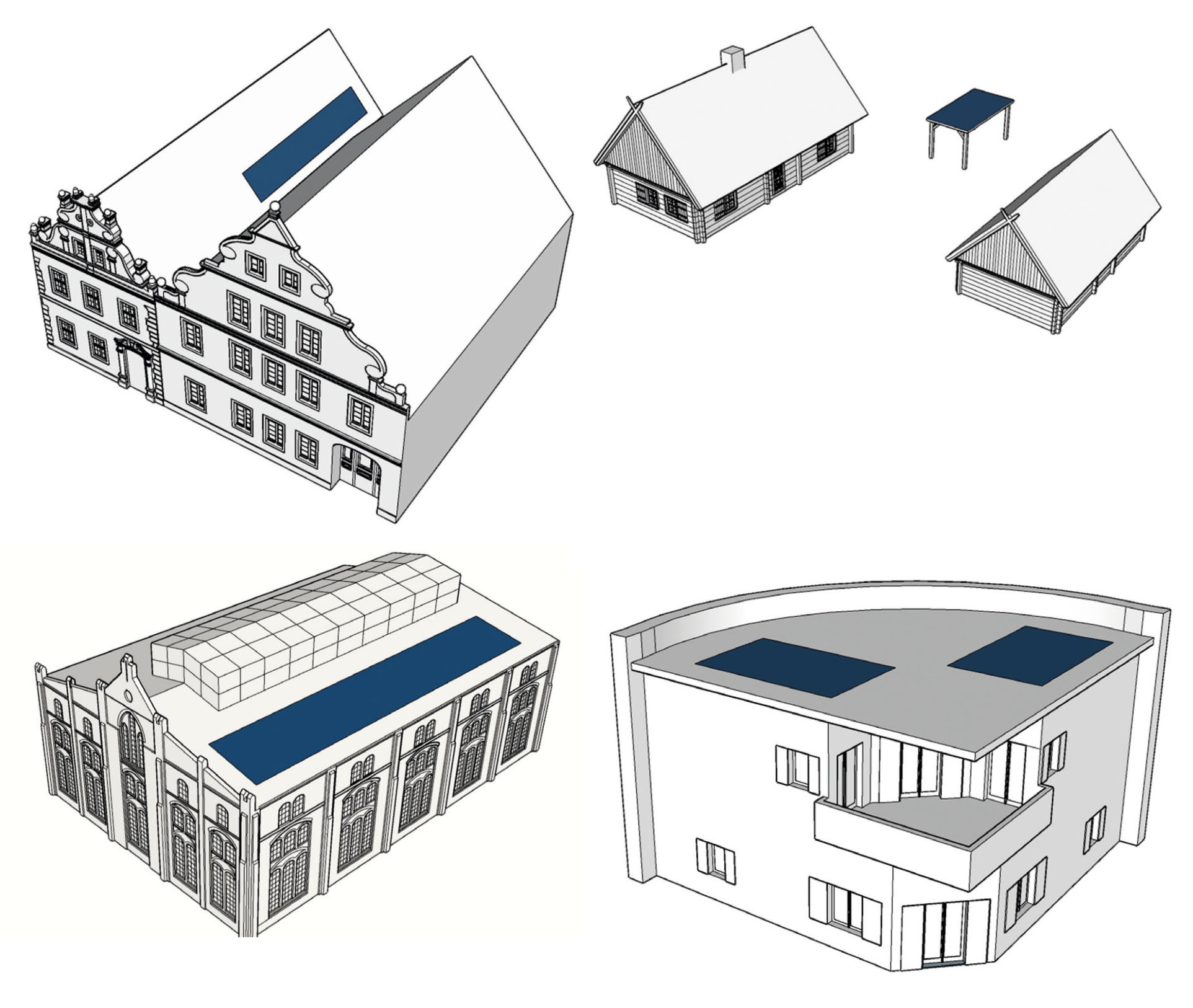
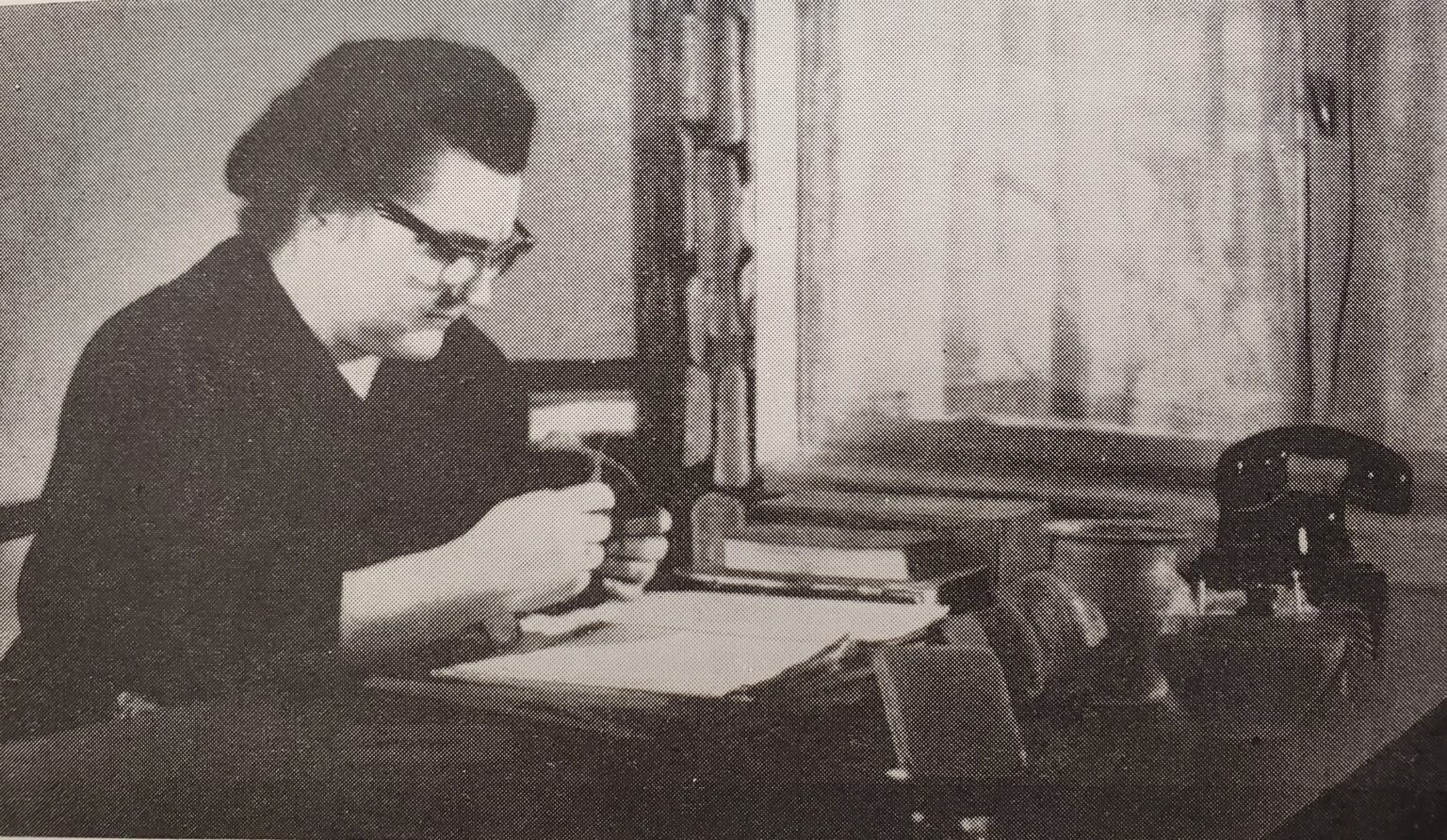







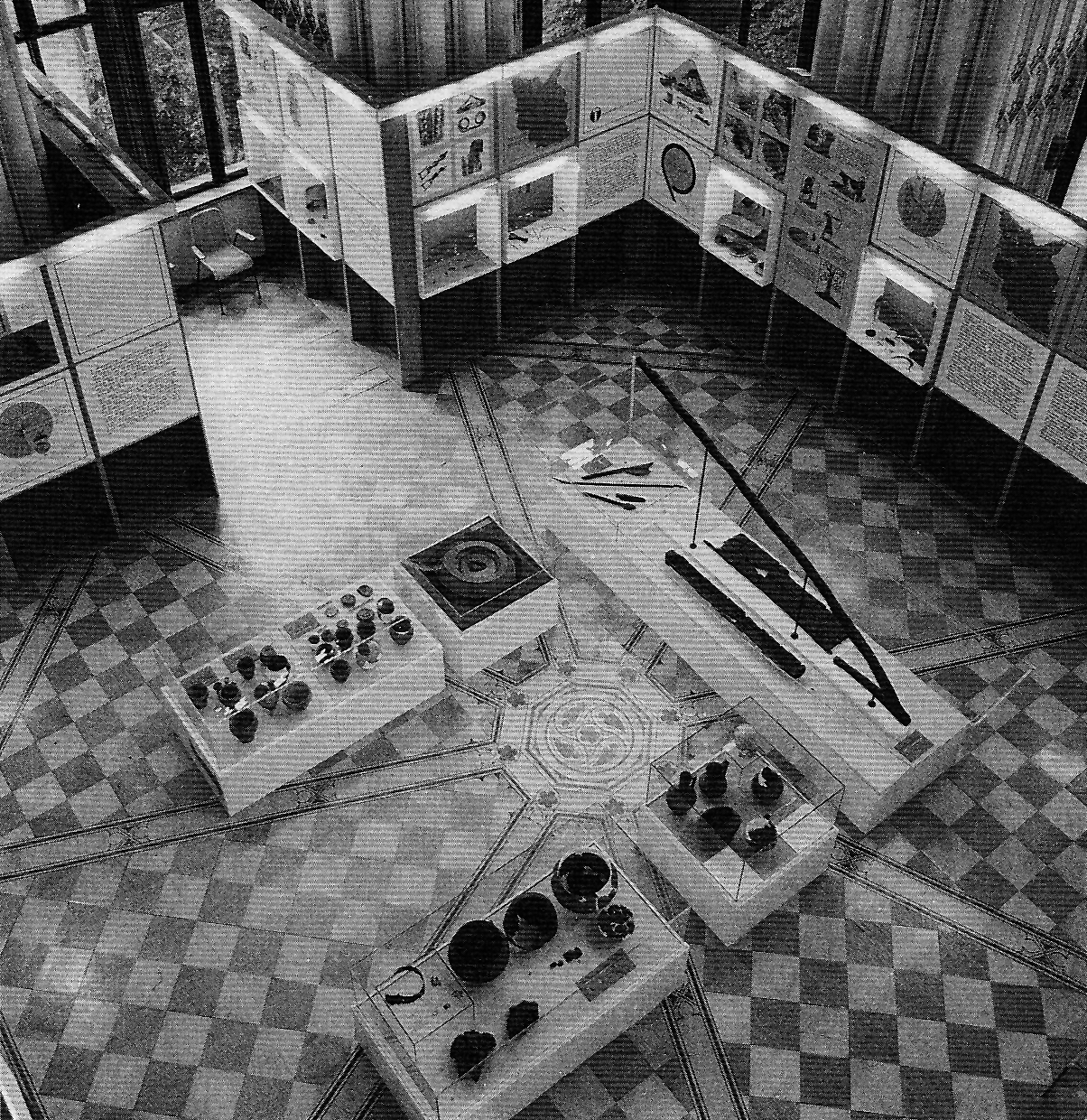
.jpg)
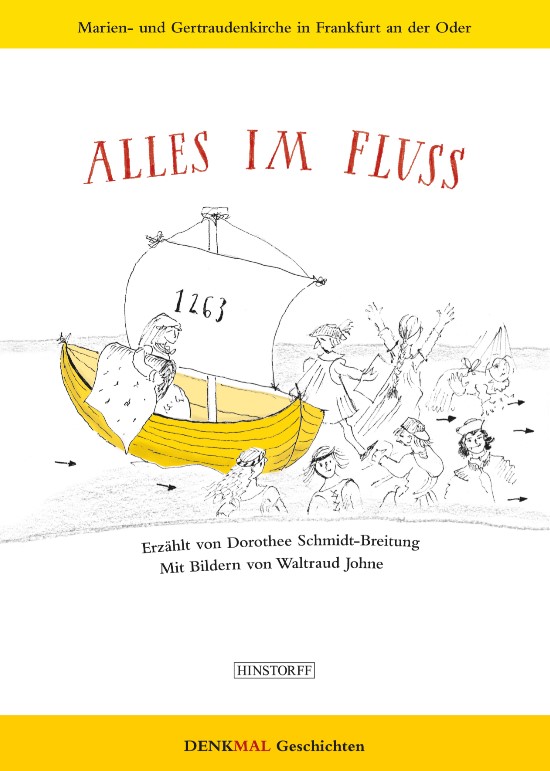
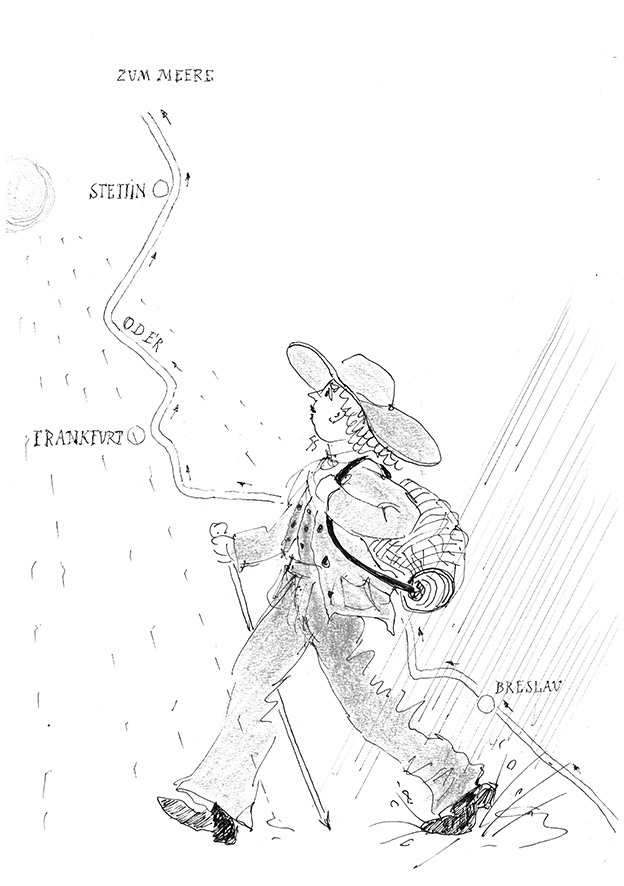






.png?origin=embed)