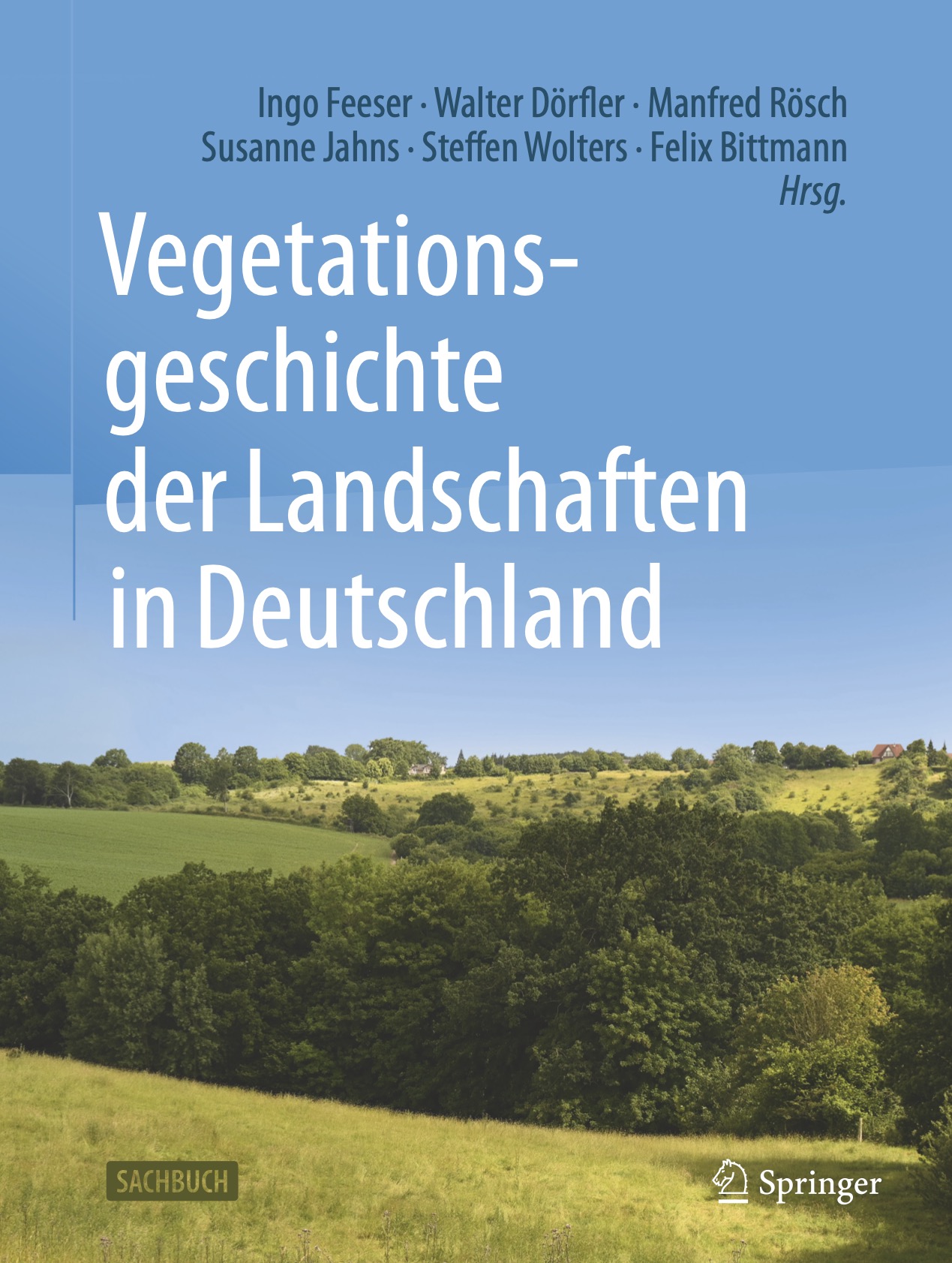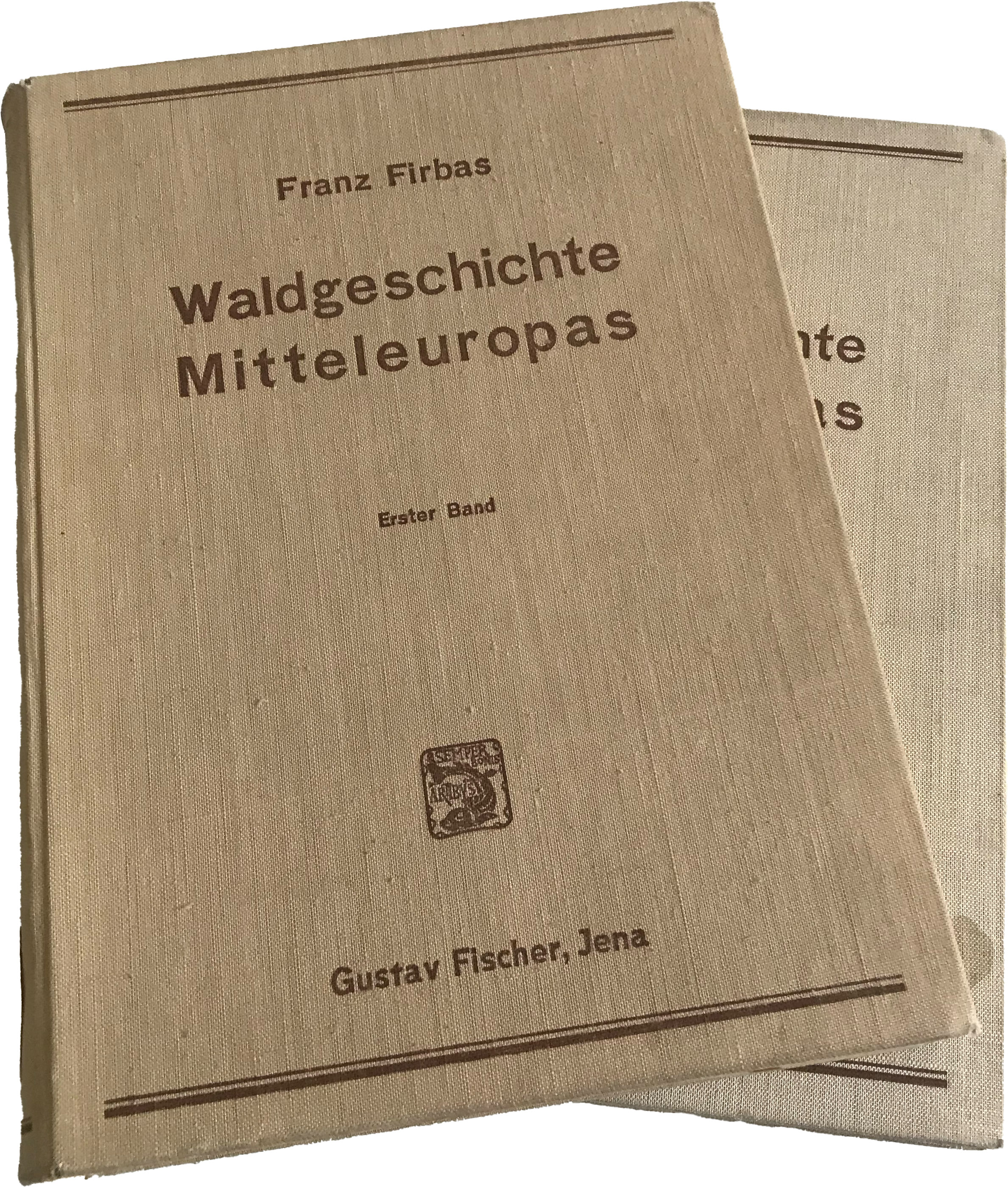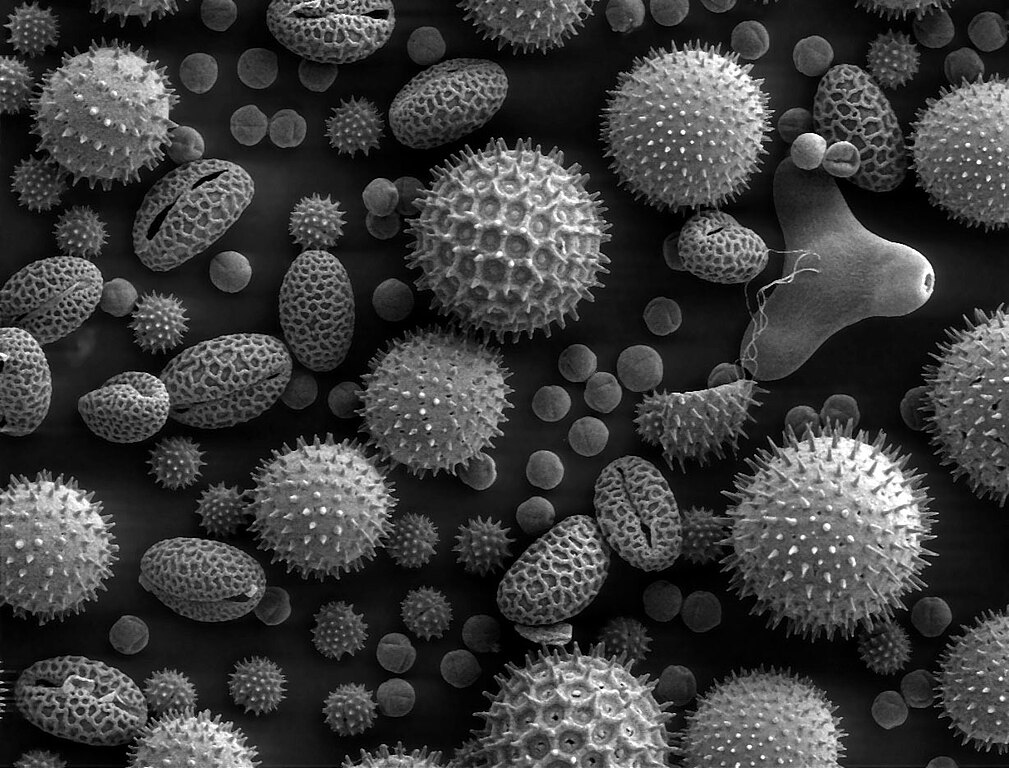Zehn Jahre Museum Himmlisches Theater im Kloster Neuzelle

Himmlisches Wetter, himmlische Reden und himmlisches Theater: Ein „europaweites Unikat“ feiert im Kloster Neuzelle Jubiläum. Vor 10 Jahren wurde das Museum Himmlisches Theater eröffnet, das seitdem jeweils zwei Szenen der barocken Passionsdarstellungen des Heiligen Grabs der Öffentlichkeit präsentiert. In dieser Folge der DENKMALZEIT haben wir uns in die barocken Festivitäten gestürzt, den himmlischen Reden gelauscht, das Depot besucht, mit Wegbegleiter:innen des Museums gesprochen und zum Schluss göttlichen Beistand gesucht und gefunden.

Gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Stiftung Stift Neuzelle, Norbert Kannowsky, sprachen für die Fördermittelgeber Brigitte Faber-Schmidt, Abteilungsleiterin Kultur im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg, Landeskonservator und stellvertretender Direktor des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums, Prof. Dr. Thomas Drachenberg, sowie Veit Kalinke als Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Oder-Spree und stellvertretend für die Ostdeutsche Sparkassenstiftung bei einem Festakt vor den aktuell ausgestellten Szenen “Gebet am Ölberg” und “Dornenkrönung Jesu”. Ein weiterer Höhepunkt war die Vorstellung des Szenenmodells durch die Denkmalpädagogin und Restauratorin Dr. Dorothee Schmidt-Breitung, die auch gleichzeitig ein neues Vermittlungsmodell präsentierte. Einblicke in das Depot erhielt man durch die versierten und spannenden Führungen von Prof. Mechthild Noll-Minor vom BLDAM.

Seit 2015 werden die Neuzeller Passionsdarstellungen im Museum Himmlisches Theater präsentiert. Die aufwendige Konservierung der nahezu 275 Jahre alten Holz- und Leinwandkulissen und Figuren bedarf großer Expertise. Die Konservierungsarbeiten werden von der Stiftung Stift Neuzelle und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum in Wünsdorf koordiniert. Heute sind noch 229 Elemente der ursprünglich wohl 240 Tafeln und Leinwände erhalten. 14 Szenen vom „Gebet am Ölberg“ bis hin zur „Grablegung Jesu“ erzählen, ergänzt durch eine Auferstehungsszene, in fünf Bühnenbildern das Leiden Jesu und bestechen durch ihre barocke Opulenz. Dabei wird jede Station der Passion Christi durch eine Figurengruppe in Bühnenbildern dargestellt. Die weiteren Figuren- und Figurengruppen kommentieren das Geschehen oder Erzählen andere Geschichten aus dem Alten und dem Neuen Testament, die mit der Passionsszene korrespondieren.

Der böhmische Künstler Johann Felix Seyfried schuf das Heilige Grab um 1751 im Auftrag des Klosters Neuzelle. Es ist mit einem besonderen Wortreichtum an Bibelzitaten ausgestattet. Das Bild- und Wortmaterial richtete sich – in einem protestantischen Umfeld – sowohl gegen die reformatorische Sicht der Eucharistie als auch gegen aufklärerisches Gedankengut. Auch heute noch zählt das Heilige Grab zu den bedeutendsten Kunstwerken im Kloster Neuzelle sowie im Land Brandenburg.
Seit dem 16. Jahrhundert wurden in der Karwoche und zur Osterliturgie vor allem in Süddeutschland und im Alpenraum Theaterarchitekturen in Kirchen aufgestellt, die den Leidensweg, die Grablegung und die Auferstehung Jesu Christi illustrieren sollten. Diese Heiligen Gräber oder Ostergräber wurden nicht für Passionsspiele genutzt, sondern dienten ausschließlich der Verinnerlichung, der Betrachtung und dem Gebet. In seinem Erhaltungszustand und der Größe der Kulissen hat das Neuzeller Heilige Grab ein Alleinstellungsmerkmal und zählt zu den sakralen Kunstwerken von europäischem Rang.
Weiterführende Links:
Zisterzienserkloster Maria Friedenshort